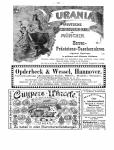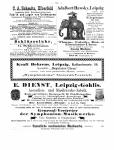Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst
- Bandzählung
- 19.1894
- Erscheinungsdatum
- 1894
- Sprache
- Deutsch
- Vorlage
- Deutsche Gesellschaft für Chronometrie e.V., Bibliothek
- Digitalisat
- Deutsche Gesellschaft für Chronometrie e.V.
- Lizenz-/Rechtehinweis
- CC BY-SA 4.0
- URN
- urn:nbn:de:bsz:14-db-id318544717-189401001
- PURL
- http://digital.slub-dresden.de/id318544717-18940100
- OAI-Identifier
- oai:de:slub-dresden:db:id-318544717-18940100
- Sammlungen
- Technikgeschichte
- Uhrmacher-Zeitschriften
- Bemerkung
- Seiten 215 und 216 fehlen
- Strukturtyp
- Band
- Parlamentsperiode
- -
- Wahlperiode
- -
- Ausgabebezeichnung
- Nr. 12 (15. Juni 1894)
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- Strukturtyp
- Ausgabe
- Parlamentsperiode
- -
- Wahlperiode
- -
- Titel
- Abbildung und Beschreibung der astronomischen Kunstuhr von E. Kanis in Netzschkau
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- Strukturtyp
- Artikel
- Parlamentsperiode
- -
- Wahlperiode
- -
- Titel
- Zur Bügelfrage
- Digitalisat
- SLUB Dresden
- Strukturtyp
- Artikel
- Parlamentsperiode
- -
- Wahlperiode
- -
Inhaltsverzeichnis
- ZeitschriftAllgemeines Journal der Uhrmacherkunst
- BandBand 19.1894 -
- TitelblattTitelblatt -
- InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis -
- AusgabeNr. 1 (1. Januar 1894) 1
- AusgabeNr. 2 (15. Januar 1894) 25
- AusgabeNr. 3 (1. Februar 1894) 49
- AusgabeNr. 4 (15. Februar 1894) 73
- AusgabeNr. 5 (1. März 1894) 97
- AusgabeNr. 6 (15. März 1894) 121
- AusgabeNr. 7 (1. April 1894) 145
- AusgabeNr. 8 (15. April 1894) 169
- AusgabeNr. 9 (1. Mai 1894) 193
- AusgabeNr. 10 (15. Mai 1894) 217
- AusgabeNr. 11 (1. Juni 1894) 241
- AusgabeNr. 12 (15. Juni 1894) 265
- ArtikelCentral-Verband 265
- ArtikelAn die Uhrmacher Süd- und Westdeutschlands! 265
- ArtikelUnsere Zeit- und Streitfragen (Schluss) 266
- ArtikelDie Stellung des Central-Verbandes zum Befähigungsnachweis und ... 268
- ArtikelAbbildung und Beschreibung der astronomischen Kunstuhr von E. ... 270
- ArtikelZur Bügelfrage 271
- ArtikelBriefwechsel 273
- ArtikelVereinsnachrichten 274
- ArtikelUhrmachergehilfen-Verein 275
- ArtikelVerschiedenes 275
- ArtikelGebrauchsmuster-Register 275
- ArtikelDeutsche Reichs-Patente 275
- ArtikelFrage- und Antwortkasten 275
- ArtikelStellen-Nachweis 276
- ArtikelAnzeigen 276
- AusgabeNr. 13 (1. Juli 1894) 289
- AusgabeNr. 14 (15. Juli 1894) 313
- AusgabeNr. 15 (1. August 1894) 341
- AusgabeNr. 16 (15. August 1894) 367
- AusgabeNr. 17 (1. September 1894) 393
- AusgabeNr. 18 (15. September 1894) 421
- AusgabeNr. 19 (1. Oktober 1894) 447
- AusgabeNr. 20 (15. Oktober 1894) 473
- AusgabeNr. 21 (1. November 1894) 499
- AusgabeNr. 22 (15. November 1894) 525
- AusgabeNr. 23 (1. Dezember 1894) 551
- AusgabeNr. 24 (15. Dezember 1894) 577
- BandBand 19.1894 -
-
271
-
272
-
273
-
274
-
275
-
276
-
277
-
278
-
279
-
280
-
281
-
282
-
283
-
284
-
285
-
286
-
287
-
288
-
289
-
290
-
291
-
292
-
293
-
294
-
295
-
296
-
297
-
298
-
299
-
300
-
301
-
302
-
303
-
304
-
305
- Titel
- Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst
- Autor
- Links
-
Downloads
- Einzelseite als Bild herunterladen (JPG)
-
Volltext Seite (XML)
— 271 — Nachdem der letzte Apostel (Judas Ischariot) seinen Segen er halten, geht er langsam der linken Seite zu, worauf Christus zurück tritt und sich dann die Thüren von selbst langsam schliessen. Ist dies geschehen, so beginnt in einer Nische unter dem Zifferblatt der Akt der Verrathung und Verleugnung. Wir sehen dort sechs Personen; auf der rechten Seite steht Petrus am Kohlenfeuer, um sich zu erwärmen, umgeben von einer Magd und zwei bewaffneten Kriegsknechten. Links davon steht Judas Ischariot, der Verräther, mit Kaifas, dem Hohenpriester. Man beobachte zuerst links Judas Ischariot und Kaifas; letzterer wendet seinen Kopf zu Judas und wieder ab, worauf Judas dieselbe Bewegung zur Antwort macht; ist dieses geschehen, so wendet sich Kaifas wieder zu Judas, erhebt seinen Arm, während sich Judas mit ganzem Körper zu ihm wendet und den Arm ebenfalls erhebt, um sich dreissig Silberlinge aufzählen zu lassen. Hat diese Judas erhalten, so wendet er sich wieder ab, um dann durch eine Wendung mit dem Köpfe seinen Dank auszusprechen. Nach diesem Akt des Verkaufes beobachte man die Gruppe rechts. Es bewegt zuerst die neben Petrus stehende Magd Kopf und Arm; sie fragt Petrus, wer er sei, und ob er den kenne, der gefangen worden ist, Petrus aber schüttelt als Zeichen der Ver leugnung mit seinem Kopf und denkt nicht daran, was ihm sein Herr beim Abendmahl gesagt hat. Dreimal giebt Petrus durch dieselben Geberden seine Verleugnung kund, worauf der auf der Spitze des linken Thurmes befindliche Hahn drei Mal seinen Siegesschrei ertönen lässt. Der linke Thurm. In diesem fallen uns zunächst zwei Engel in die Augen; in der untersten Etage sitzt ein Engel auf einem altarähnlichen Sessel, in der rechten Hand ein Szepter und in der linken ein Glöcklein haltend. In der dritten Etage steht ein Engel mit dem linken Fuss auf einem Todtenkopf, er hält in der rechten Hand ein Schwert und in der linken ebenfalls ein Glöcklein. Die beiden Engel sind bestimmt, die Viertelstunden anzuschlagen, und zwar so, dass nach Ablauf jeder Viertelstunde der eine mit dem Szepter den ersten Viertelstreich und der andere mit dem Schwert den zweiten Viertelstreich auf dem Glöcklein ertönen lässt. In der zweiten Etage befindet sich ein Engel, der Tag und Nacht allstündlich 3600 Sekunden zu zählen hat; dieses zeigt er uns durch fortwährende Bewegung mit Kopf und Armen, wobei er in jeder Hand abwechselnd ein Stäbchen erhebt und den Kopf auf den zu erhebenden Stab richtet. In der vierten Etage erscheinen nacheinander vier Figuren als Sinnbilder der vier Jahreszeiten. So sieht man z. B. im Frühling einen Kunstgärtner, welcher einen Blumenkorb in seinen Armen trägt, über seinem Kopfe ist der Frühling in goldenen Buchstaben angebracht. Er harrt nun an seiner Stelle bis an den Tag, an welchem der Sommer seinen Anfang nimmt. Der Wechsel dieser die Jahreszeiten darstellenden Figuren wird am Tage des Anfangs einer neuen Jahreszeit in einem Augenblick bewirkt. Nach Verschwinden des Gärtners erscheint sofort ein Landmann, welcher als Schnitter die Sense auf seiner Schulter trägt. Ueber ihm sieht man ebenfalls wieder den Sommer in goldenen Buchstaben stehen. Ist nun der Sommer vergangen, so verschwindet gleichfalls der Landmann in einem Augenblick und an seiner Stelle steht ein Weingärtner, der in seinem Arme einen Weinkorb trägt, über ihm sieht man wieder das Wort Herbst in goldener Schrift auf schwarzer Tafel. Nach Beendigung des Herbstes, was in 3—4 Tagen vor dem Weihnachtsfeste ge schieht, verlässt der Weingärtner seine Stelle, um dem zur Zeit passenden Weihnachtsmann Platz zu machen, der dann wieder mit seinem Christbaume den Frühling erwartet. Ueber der vierten Etage erhebt sich ein geschnitzter Aufsatz, der eine Zierde des Thurmes ist. Die den Thurm abschliessende ;Halbkugel dient zum Stand des Hahnes, der sich in natürlicher Grösse eines Zwerghahnes stolz darauf bewegt. Man hat nun diesen Hahn genau zu beobachten. Wenn er seinen Dienst zu verrichten hat, hebt er viermal langsam seine Flügel, beim vierten Mal erhebt er seinen Leib, streckt seinen Hals nach vorn, öffnet seinen Schnabel und fängt aus voller Brust in starkem Tone an zu krähen. Diese Bewegungen führt er aus, nachdem Petrus die letzte der drei Verleumdungen offenbart hat. Nach jedem Schrei sinkt seine Stimme in naturgetreuer Weise, ebenso nimmt sein bis dahin vorgestreckter Leib die frühere Lage wieder ein; auch kräht er weder zu früh noch zu spät, der Mechanismus tritt genau zu der ihm festgesetzten Sekunde in Kraft. (Schluss folgt.) Zur Biigelfrage. Die letzten Nummern unsers Organs haben die gründliche Besprechung der Frage Seitens zweier Fachgenossen gebracht; heute sind wir in der angenehmen Lage, diesen Abhandlungen eine dritte und zwar von fachwissenschaftlicher Seite folgen zu lassen. Wir hatten einem uns befreundeten höheren Staats beamten das bis dahin vorhandene Material übersandt und sind hocherfreut, dass unserm Wunsch nach einer Meinungsäusserung sobald und in so erschöpfender Weise Folge gegeben worden. Unser Freund schreibt: „Was die Aeusserungen der Herren Neuhofer und Felsz über den Augsburger Urtheilsspruch betrifft, so kann ich keine von beiden als vollständig zutreffend anerkennen. Ich bin aber der Meinung, dass Herr Felsz den eigentlichen Kern der Sache viel klarer erfasst und behandelt hat, als Herr Neuhofer. Seine eingehende Würdigung der Motive des Gesetzes, lässt mich sogar vermuthen, dass er mit zu den Sachverständigen gehört hat, die von der Kegierung oder der Reichstagskommission zu der Entwurfsfeststellung hinzugezogen worden sind. Meines Erachtens ist der ganze Streit, wie leider in so vielen Fällen, auf die nicht genügend bestimmte Fassung des Gesetzes, speziell der §§ 4 und 8 zurückzuführen und an dieser Fassung, wenig stens der des § 8, sind, wie ich aus den mir vorliegenden Ver handlungen der Reichstagskommission ersehe, die Herren Sach verständigen nicht ohne Schuld. Ehe ich mich indessen weiter hierüber auslasse, will ich zunächst die Beantwortung der mir von Ihnen gestellten Fragen versuchen, obgleich ich der Ansicht bin, dass sie für die Entscheidung des Rechtsstreites nicht von wesentlicher Bedeutung sein werden. Zur Entscheidung der Frage, ob der Bügelring an und für sich oder in Verbindung mit der Uhr eine mechanische Vorrichtung sei, ist vor Allem die Feststellung des Begriffs „mechanische Vorrichtung“ er forderlich. Das ist nun aber in völlig einwandsfreier Weise kaum möglich, weil der gewählte Ausdruck eigentlich keine wissen schaftliche Bezeichnung ist und deshalb auch nicht klipp und klar wissenschaftlich bestimmt werden kann. Ist es doch bis heute noch nicht gelungen, den wissenschaftlichen Ausdruck , „Mechanismus“ in allseitig befriedigender Weise begrifflich festzulegen. Die Bezeichnung „Vorrichtung“ ist mehr oder weniger ein Verlegenheitsausdruck für alle möglichen Dinge, für die es an einem besonderen Faehausdruck gebricht. Sie ist dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommen und ihr Wesen demgemäss nach diesem zu beurtheilen. In ihrer allgemeinsten Bedeutung würde man unter „Vorrichtung“ jeden Gegenstand verstehen können, der in Rücksicht auf einen bestimmten Zweck, dem er dienen soll, eine besondere Form oder Einrichtung erhalten hat. Ein Lineal würde hiernach als eino „Vorrichtung“ gelten können. Indessen glaube ich doch, dass diese Auslegung sich mit dem allgemeinen Sprachgebrauch nicht deckt, bin vielmehr der Ansicht, dass der Begriff einer „Vorrichtung“ nach diesem Sprachgebrauch ein aus mehr als 1 Theil künstlich zusammen gestelltes Ganzes voraussetzt, in dem die Art der gegenseitigen Verbindung der Einzeltheile durch den Zweck bestimmt worden ist, dem das Ganze (die Vorrichtung) dienen soll. Eine „mecha nische Vorrichtung“ würde hiernach folgerichtig eine Vor richtung sein, deren Einzeltheile mechanisch, d. h. wie die Einzeltheile oder Glieder eines Mechanismus, mit einander ver bunden sind. Zum besseren Verständniss einer solchen Verbin dung ist es nothwendig, auf den Begriff des „Mechanismus“ etwas näher einzugehen. Unter „Mechanik“ im engeren Sinne, mit Ausschluss der Statik, versteht man bekanntlich die Lehre von der Bewegung oder Ortsveränderung der Körper. Nach Wiebe, einem der älteren Lehrer der Mechanik und des Maschinenbaues, bilden nun zwei oder mehr Widerstands-
- Aktuelle Seite (TXT)
- METS Datei (XML)
- IIIF Manifest (JSON)
- Doppelseitenansicht
- Keine Volltexte in der Vorschau-Ansicht.
- Einzelseitenansicht
- Ansicht nach links drehen Ansicht nach rechts drehen Drehung zurücksetzen
- Ansicht vergrößern Ansicht verkleinern Vollansicht